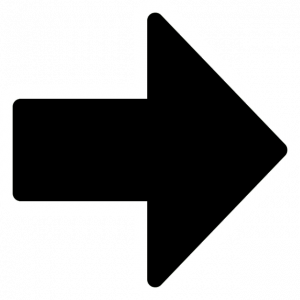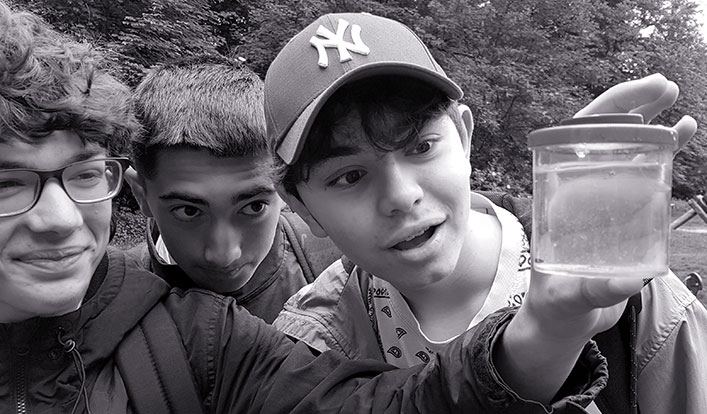
16.06.2023 | Biologie, Exkursionen, MINT, News
Wie pumpt ein Baum Wasser aus den Wurzeln in die obersten Blattspitzen, wie betreiben Pflanzen im Schatten Fotosynthese, wie unterscheidet man Kaulquappen von Kröte und Frosch und warum hat der Farn eigentlich drei Geschlechter?
Das Jahresthema „Ökologie“ im Biologieunterricht der Klasse 8 hält viele interessante Fragen bereit, denen man am besten am lebenden Beispiel in der Natur nachgehen müsste. Weil das aber im Unterricht nicht immer möglich ist, bemühen sich die Biologielehrer/innen am Goethe Gymnasium, so oft wie möglich die Natur ins Klassenzimmer zu holen und wenn es geht, praktisch zu arbeiten.
Mindestens einen Unterrichtsgang sieht der Lehrplan im Fach Biologie vor, der sinnvollerweise gegen Ende des Schuljahres stattfinden sollte. Erstens haben die Schüler/innen bis dahin die theoretischen und fachlichen Grundkenntnisse erworben, um ökologische Phänomene richtig einordnen zu können, und zweitens ist das Wetter einfach besser.
Nur drei Haltestellen vom Goethe Gymnasium entfernt bietet sich der Grafenberger Wald ideal für einen solchen Unterrichtsgang an. Das gesamte Gebiet ist vom Gartenbauamt unter pädagogischen Gesichtspunkten gestaltet; Hinweistafeln, bewusst naturbelassene Sukzessionsflächen, Naturteiche und Bodeneinschläge bieten vielfältige Anlässe, um Lehrplaninhalte zu wiederholen und zu vertiefen. Im Bodeneinschlag z.B., ein ca. 4 Meter tief ausgebaggertes Stück Waldboden, können Boden- und Zersetzungsschichten sichtbar und im Sinne des Wortes auch „be-greifbar“ (sic) gemacht werden.
 Auch der vielfältige Baumbestand mit Eichen, Ahorn, Buchen und Kiefern lädt zu intensiven Naturbetrachtungen ein.
Auch der vielfältige Baumbestand mit Eichen, Ahorn, Buchen und Kiefern lädt zu intensiven Naturbetrachtungen ein.
Auf den zahlreichen verschlungenen Wegen des Grafenberger Waldes können auf diese Weise in zwei Schulstunden ökologische Phänomene mit allen Sinnen erfahren werden.
Michael Tech

26.03.2023 | BNE, Erdkunde, Exkursionen, News
Ganz in der Nähe von Düsseldorf befindet sich das Ruhrgebiet; ein Gebiet geprägt von Stahl und Kohle während der Industrialisierung. Vor allem die „Gutehoffnungshütte“ in Oberhausen hat einen massiven Strukturwandel erlebt.
„Strukturwandel, die mit der marktwirtschaftlichen Dynamik verbundenen, mehr oder weniger stetigen Veränderungen der wertmäßigen Beiträge der einzelnen Wirtschaftszweige und Wirtschaftssektoren zum Sozialprodukt.“ ~ Bundeszentrale für politische Bildung
Die beiden Erdkundekurse der Q1 (LK und GK) machten sich zusammen mit Claudia Schall, Anja Roth und Johannes Budde am 15. März 2023 mit der Bahn auf nach Oberhausen, um sich den Strukturwandel einmal selbst anzuschauen, denn zuvor haben sie sich im Unterricht intensiv mit dem Thema „Wirtschaft im Wandel“ beschäftigt.
Beide Kurse haben eine Führung von Frau Mohr bekommen. Die Basis ihres Vortrags bildete eine Fotografie über das Gelände der Gutehoffnungshütte aus dem Jahr 1952. Dort war bis 1990 einer der größten Bergbau- und Hüttenbetriebe. Bemerkenswert daran ist, dass auf dem Gelände auch hochrangige Manager gewohnt haben. Diese haben in ihrem Garten Gemüse angebaut. Man stelle sich aber bitte vor, dass das ganze Gebiet von Ruß und Smog durchzogen war, was durch die Maschinen und Hochöfen ausgestoßen wurde.
Des Weiteren ist der Gasometer entstanden, weil die Menschen festgestellt hatten, wie viel Gas beim Produzieren von Stahl als Abfallprodukt entsteht. Das Gas kann somit anderweitig genutzt werden. Im Gasometer wurde dieses dann zwischengelagert. Gas hat als Eigenschaft sich im ganzen Raum auszubreiten, sodass nicht sichtbar war, wie viel Gas sich im Gasometer befand. Daher war der Gasometer ein sogenannter Schwebegasbehälter. Eine Betonplatte lag auf dem Gas auf, und man wusste, wie viel Gas sich darin befand, wenn die Gasmenge stieg und die Platte hochdrückte.
Jetzt stellt sich nur die Frage, was ist aus der Gutenhoffnungshütte geworden?
Heute ist das Gebiet vom tertiären Sektor geprägt, was bedeutet es ist geprägt von Dienstleistungen (Einzelhandel, Freizeitattraktionen, Gastronomie). Unter anderem ist es bekannt für das Centro, SeaLife, Legoland, ein Kino, die Promenade und die Coca-Cola Oase, die sich im Centro befindet. Der Gasometer selbst wird für Ausstellungen genutzt. Seit Oktober 2021 ist dort die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ zu sehen, die auf drei Stockwerke verteilt ist.

zu Fotos!
Erdgeschoss: Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Panoramabild, das das Areal der Gutehoffnungshütte vor dem Strukturwandel zeigt. Im Erdgeschoss befinden sich ebenfalls viele Bilder, die die schönen Seiten der Natur vor dem Klimawandel zeigen.
Ebene 1: Ein Stockwerk höher werden die Folgen des Klimawandels anhand von Tierbildern dargestellt. Diese beschäftigen sich jeweils mit unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel der Verschmutzung der Ozeane oder den Waldbränden in Australien.
Ebene 2: Ganz oben befindet sich eine sehr große Weltkugel, die in der Luft schwebt. Auf dieser wird ein 17-minütiges Video abgespielt, das unter anderem die verschiedenen Handelsströme per Schiff und Flugzeug von 2018-2019 zeigt. Von dieser Ebene aus kann man auch mit einem Aufzug nach oben aufs Dach fahren oder man nimmt die Treppe, die sich draußen am Gebäude befindet.
Einen Eindruck von der Ausstellung können Sie erhalten, wenn Sie auf das Bild oben klicken.
(von Madleen Baumann, Nathalie Link und Johanna Overlack, Q1 EK LK)
Claudia Schall
Johannes Budde

22.03.2023 | Exkursionen, News, Politik
Die Sowi-Kurse der EF sowie der Sowi-LK aus der Q1 besuchten am Montag, den 20.03.23 den NRW-Landtag in Düsseldorf. Dort durften sie im Plenarsaal die Plätze der Abgeordneten einnehmen und eine Landtagsdebatte zum Gesetzentwurf „Wahlrecht ab Geburt“ durchspielen. In gut vorbereiteten Reden lieferten sich die SchülerInnen ein spannendes Wortgefecht. Anschließend nahmen sich die beiden Abgeordenten Stefan Engstfeld und Arndt Klocke von den Grünen die Zeit, die Fragen der SchülerInnen zur Arbeit eines Abgeordneten und zu aktuellen politischen Themen zu beantworten. Die SchülerInnen beeindruckten die Abgeordeten mit ihren kritischen Fragen, die von Lützerath, über die Wochenarbeitszeit eines Abgeordeten bis zu den Gründen in die Politik zu gehen, reichten.“
Bastian Zabelberg

16.03.2023 | Bilingual, Exkursionen, News, Sprachen
Nach langer Coronapause konnte dieses Jahr endlich wieder der bilinguale Austausch mit unserer Partnerschule Pius-X College in den Niederlanden in vollem Umfang stattfinden. In Begleitung von den beiden Englischlehrerinnen Kim Biermann und Claudia Schall besuchten 26 Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen vom 13. – 15. Februar 2023 ihre Austauschpartnerinnen und -partner in Bladel, in der Nähe von Eindhoven. Neben dem niederländischen Schulalltag, lernte unsere Schülergruppe auch das Leben in ihren niederländischen Gastfamilien kennen. Den genauen Ablauf der drei Tage schildern unsere beiden Schülerinnen Eve Pokrass und Maris Jahn aus der 8b in ihrem auf Englisch verfassten Erlebnisbericht:
The bilingual student exchange, which was optional for all 8th graders and accompanied by Mrs Biermann and Mrs Schall, took place in a wonderful town called Bladel, which is located in the Netherlands. The journey was around 2 hours by bus, and everyone was very excited about the three days in Bladel. When we arrived, the first thing we noticed was the huge modern school, the Pius X-College, and the many bikes in front of the building. With our suitcases in hand, we saw a group of children of our age walking towards us. Only a few moments later everyone found their exchange partner. They gave us a warm welcome, and we were offered a tasty lunch including sausage rolls and hot chocolate. We talked about the daily programme, and after that we had an interactive game throughout the school, where we had to find clues from diverse puzzles, and give a code into a laptop, which we figured out in the process of the game. We had a limited amount of time, and the group that had the most correct answers and finished first got a prize, which was a delicious cake and lots of candy.
The next interesting game we played was called the ‘Big Ball Bonanza’ in the sports hall. Working in partners, you had to ensure the softballs didn’t touch your mat, only using your arms, feet, and body to defend. This was lots of fun, and many people’s highlight!
After the school programme ended, each of us went to the house of their hosts. After meeting the families, some of us went out in Bladel to meet friends and eat together. We met at a local restaurant, while other staff went bowling. The Dutch food is very teenage friendly. The chips with mayo, and the Dutch Frikandel were the absolute highlight. We continued the adventure further, and some of us were invited to watch a movie together.
The next morning most of us cycled to school, which even though it was cold, and some lived so far out the trip was 45 minutes long, the views of the sunrise, and the stars at night made it all worth it.
The next activity was a day trip to Antwerp. We travelled by bus. Antwerp is a very nice town with a rich history. We had a long walk in the centre, and we visited the MAS museum, which offered astounding views of Antwerp from the top floor; the Brabo Statue, the city hall, and we took many photographs. After a lunch break and some free time, we then did a photo tour of Antwerp. Navigating our way through the city, and taking photos of landmarks really was an experience to remember!
We spent the last day of our stay at school. We attended different workshops, such as: Art class, Biology, Science, Bliss (which means learning a new language), and Star Wars.
In the Science workshop, we played detectives, having to distinguish different powders to see which are drugs, and which are harmless. To do so, we had to conduct experiments and research different ways to identify the drug.
During the Star Wars workshop, we talked about the Space Race, the first man made object ever to leave the earth’s atmosphere called Sputnik; about Laika, a stray dog from the streets of Moscow that occupied the Soviet spacecraft Sputnik 2, and was launched into outer space. We even talked about the first steps of Neil Armstrong on the Moon in 1969.
For a lot of us, the best activity of the day was the Biology Workshop. In this workshop, we dissected owl pellets (which had been in the freezer long enough to have killed any bacteria), and took out whole animal bones, which we then glued on paper to create our own monster! We could really get a close insight into the skeletal system of different animals, such as moles and mice. We learned that the owls cannot digest the fur and bones of its prey and a special organ in the owl separates the bones and fur from the meat.
Lastly, we had an evaluation together, and we talked about the funniest parts of the trip.
After the cool workshops and the great time spent with our hosts, our time in Bladel was approaching its end. Full of great memories, new experiences, and new friends, we said a heartfelt goodbye to our Dutch friends, and got on the bus back to Düsseldorf! We are looking forward to welcoming our friends to Düsseldorf in May.
(by Eve Pokrass and Maris Jahn, 8b)
Claudia Schall
Kim Biermann

01.03.2023 | BNE, Erdkunde, Exkursionen, News
Als Abschluss einer Unterrichtsreihe zu Stadtgeographie unternahmen die beiden Erdkunde-Grundkurse der Q2 unter der Leitung von Johannes Budde, begleitet von den Referendarinnen Elena Frangou und Anja Roth, eine Tagesexkursion durch Düsseldorf, um die Thematik „Stadtentwicklungsprozesse im Nahraum“ exemplarisch zu erfassen. Das Besondere bei dieser Exkursion war die hohe Eigenständigkeit der Schüler:innen, da diese als eine Mischung aus Spurensuche, Arbeits- und Überblicksexkursion einzelne ausgewählte Standorte in Düsseldorf selbständig vorbereitet hatten. Im Vorhinein haben sie ihr Konzept für den Standort ausgearbeitet und vor Ort dann zuerst ihre Mitschüler:innen kurz über die Besonderheiten des Standortes informiert, bevor diese dann kleinere Aufgaben zu bewältigen hatten. Das hohe Engagement und die Vielfältigkeit der von den Schüler:innen gewählten Themen und Methoden war dabei bemerkenswert.
Gestartet ist die Exkursion um 8 Uhr in Gerresheim, wo die ehemalige Glasfabrik inklusive der Freifläche hinsichtlich der historischen wie aktuellen Bedeutung für den Stadtteil analysiert und beurteilt wurde. Danach haben wir uns die Auswirkungen der Gentrifizierung in Flingern im direkten Schulumfeld an der Ackerstraße angeschaut. Hierfür sollten die Lernenden verschiedene Rollen der Nutzer:innen des Stadtviertels einnehmen, wie beispielsweise Künstler:innen, Einwohner:innen und Investor:innen und aus diesen Perspektiven Zukunftsvisionen für das Viertel entwickeln.
Nachdem der revitalisierte Wohnkomplex „Le Flair“ auf dem Gebiet des ehemaligen Güterbahnhofs in Derendorf besichtigt wurde, lag der Fokus auf der Innenstadt, wo neben der Suche nach „places to be“ rund um den Kö-Bogen 2 unter anderem auch eine weitere Besonderheit von Düsseldorf thematisiert wurde: Düsseldorfs Gated Community – Das Andreasquartier. Hier konnten die Jugendlichen spontan noch eine Führung des Portiers bekommen mit Hintergrundinformationen, wie beispielsweise, dass die Kaltmiete einer 40m² Wohnung um die 3000€ liegt.
Die Exkursion endete mit einer Expertenführung durch den Medienhafen von der Leiterin des Düsseldorfer Zentrums für schulpraktische Lehrerbildung Dr. Anke Philipp. Die ehemalige Erdkundelehrerin legte auch hier den Fokus auf die Veränderungen der Nutzung des Hafengebietes in den letzten Jahrhunderten, wobei die Lernenden diese aktiv anhand von historischen Bildern gekennzeichnet haben.
Aufgrund des größtenteils eigenständigen Lernens vor Ort konnten die Schülerinnen und Schüler das aus dem Unterricht Gelernte in einem ihren bekannten Umfeld anwenden und somit das Klassenzimmer mit ihrer Lebenswelt verknüpfen.
(von Elena Frangou & Anja Roth (Referendarinnen))
Johannes Budde

19.12.2022 | Biologie, Exkursionen, MINT, News
Der Bio Leistungskurs war zusammen mit ein paar sehr interessierten Schüler:innen der Bio Grundkurse am 07.12.22 unterwegs auf den Spuren des genetischen Fingerabdrucks bei KölnPUB in Frechen. Die Exkursion findet jährlich statt. Daher kamen die begeisterten Schülerinnen und Schüler auf die Idee, die Exkursion mit weniger Text aber dafür mehr Bildern in Form eines Padlets zu präsentieren. Klicken Sie auf das unten stehende Bild und erleben Sie die Exkursion in Foto und kurzen Videos!

Stefanie Wirth
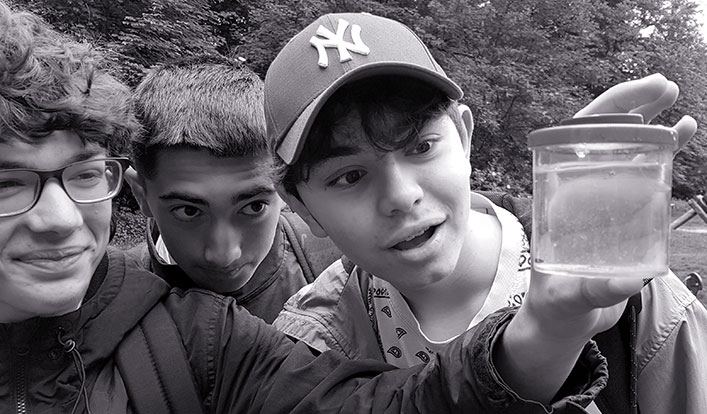
 Auch der vielfältige Baumbestand mit Eichen, Ahorn, Buchen und Kiefern lädt zu intensiven Naturbetrachtungen ein.
Auch der vielfältige Baumbestand mit Eichen, Ahorn, Buchen und Kiefern lädt zu intensiven Naturbetrachtungen ein.